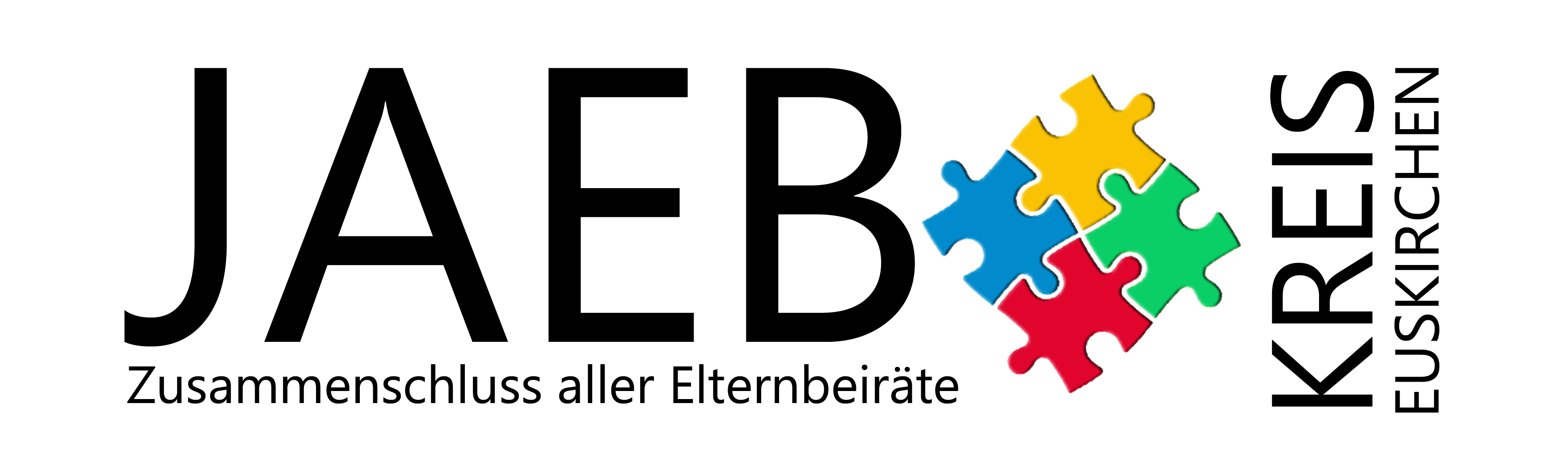Wir durften mit den beiden Landratskandidaten, für die anstehenden Wahlen am 14. September 2025, über das Thema frühkindliche Bildung, Kita und Familie sprechen.
Landrat Markus Ramers und Anwärterin Sabine Preise-Marian haben uns Rede und Antwort gestanden.
Hierbei haben wir beiden Kandidaten die identischen sechs Fragen gestellt. Hier findet ihr eine Zusammenfassung aus den beiden Terminen, mit den jeweiligen Antworten der Kandidaten.
Frage 1:
Im Hinblick auf den Fachkräftemangel haben viele Träger (freie wie auch kommunale) um den Kreis
herum die maximale Betreuungszeit auf 35h reduziert. Ist dies auch im Kreis Euskirchen angedacht?
Und wie wollen Sie stattdessen mit dem Fachkräftemangel umgehen? Wie sollen junge Menschen für
diesen Beruf begeistert werden und wie stellt sich der Kreis auf, wenn OGS für alle verpflichtend
angeboten werden muss und auf die gleichen Ressourcen zurückgegriffen wird?
Sabine Preiser-Marian:
Fachkräftemangel muss vielschichtig betrachtet werden, die Reduzierung der Betreuungszeit wird
immer diskutiert, jedoch muss das volle Stundenpotential für die Attraktivität des ländlichen Raums
erhalten bleiben. Die jungen Menschen sollten schon früh über diese Berufe informiert werden (z.B.
in Schulen), um mehr Menschen für den Beruf zu begeistern.
Markus Ramers:
Eine Reduzierung der Betreuungszeiten auf 35 Stunden im Kreis Euskirchen ist nicht
vorgesehen. Bisher werden die 45-Stunden-Plätze ohnehin nur sehr restriktiv vergeben, zum Beispiel
mit Arbeitgebernachweis. Grundsätzlich ist 2024 eine Fachkräfteoffensive gestartet worden, um
mehr Nachwuchs zu gewinnen und den Beruf stärker zu bewerben. Allerdings gibt es strukturelle
Probleme: So ist eine Klasse für Kinderpfleger*innen am Berufskolleg Kall nicht zustande
gekommen, und auch für die Heilerziehungspflege gibts es im Kreis bislang keine
Ausbildungsmöglichkeiten.
Eine große Herausforderung besteht im künftigen OGS-Rechtsanspruch, da dann zusätzlich
Fachkräfte benötigt werden. Kita, OGS und Pflege greifen alle auf denselben Fachkräfte-Pool
zurück. Um gegenzusteuern, wird das Berufskolleg Kall umgebaut, um zusätzliche
Ausbildungsgänge zu schaffen. Kampagnen zur Berufswerbung sind sinnvoll, aber nicht nachhaltig,
wenn die Träger nicht mit praxisorientierten Ausbildungsmodellen wie PiA mitziehen. Wichtig ist es,
jetzt ausreichend auszubilden, um beim Start des OGS-Rechtsanspruchs nicht in personelle Engpässe
zu geraten.
Frage 2:
Die Versorgung der unter 3-Jährigen (U3) lag im aktuellen Kitajahr bei 62,9 %, was einen Rückgang
von 3,6 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr darstellt. Mit Blick auf die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf – wie wollen Sie diese zukünftig durch Maßnahmen auf Kreisebene stärken, sowohl bei der
Betreuungsquote als auch bei der Stärkung der Infrastruktur?
Sabine Preiser-Marian:
Der Bedarf an Kitaplätzen muss passen, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf muss gesichert sein.
Es ist eine große Herausforderung das alles richtig zu planen. Die berufstätigen Eltern brauchen
Sicherheit, der Standort der Kitas sollten wohnortnah sein und auch über Kommunalgrenzen sollte
man im Bedarfsfall hinweg schauen. Zudem müssen Haushalte in Kommunen valide eingestellt sein,
um bei der Infrastruktur und Betreuungsquote durch Invest helfen zu können. Bei freien Plätzen soll
kommunalweit geholfen werden, auf Einzel-fälle soll geschaut und im Dialog abgestimmt werden.
Markus Ramers:
Es gab Anrufe von Eltern , die zwar die offene U3-Plätze gesehen haben, aber keinen Platz in ihrer Wunschkita bekommen haben. Die Kinder müssen besser auf freie Plätze verteilt werden. Dazu müssen starre Grenzen über Stadt- und Gemeindegrenzen hinweg aufgelöst werden, damit Kinder auch übergreifend aufgenommen werden können. Ein weiteres Problem sind die Investitionsförderungen des Landes. Ohne diese ist der Ausbau neuer Einrichtungen sehr schwierig, wie man beim „Bunten Wald“ in Zülpich gesehen hat, wo eine Zusage erst spät kam. Wenn Kommunen zu lange mit Anträgen warten, entstehen Engpässe. Deshalb muss der Kreis künftig stärker steuernd eingreifen und früher aktiv werden. Ein Beispiele, die „Weiße Erde“ oder den Hertener Weg in Zülpich, wo entweder zu groß oder zu klein geplant worden ist. Ich plädierte für modulare Bauweisen, um auf steigende Bedarfe flexibler reagieren zu können. Insgesamt ist eine gute Kommunikation zwischen allen Beteiligten immens wichtig.
Frage 3:
Besonders im Hinblick auf steigende Wohnkosten und die teure Kinderbetreuung stellt sich die Frage:
Welche zusätzlichen finanziellen Entlastungsmaßnahmen für Familien sind geplant, um Armut und
soziale Ungleichheit zu vermeiden? Wird das dritte beitragsfreie Jahr erneut ein Thema werden –
auch wenn dies auf Landesebene in dieser Amtszeit nicht mehr umgesetzt wird? Falls nicht: Welche
weiteren Maßnahmen sind angedacht? Wie sieht es mit einer erneuten Anpassung der
Beitragstabelle aus?
Sabine Preiser-Marian:
Die Beitragstabelle wurde angepasst und ist sozial-gerecht. Alleinerziehende & Geringverdiener
wurden abgefangen. Die Beitragstabelle nach oben weiter zu steigern ist nicht der erste Ansatz.
Familienentlastung sollte grundsätzlich unser Ziel sein und offen die Möglichkeiten ergreifen, die sich
auftun. Ein weiterer Fokus liegt bei dem wichtigen Thema Inklusion und das zugehörige
Antragswesen. Ggf. sollten in Kitas die Essensbeiträge geprüft werden, da diese deutliche
Unterschiede aufweisen.
Markus Ramers:
Die Kindertagesbetreuung kostet den Kreis über 100 Millionen Euro. Nur etwa 3,5
Millionen Euro werden hierbei durch Elternbeiträge eingenommen – und dafür sei ein erheblicher
bürokratischer Aufwand nötig, da Einkommensnachweise geprüft werden müssten.
Frühkindliche Bildung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Elternbeiträge könnten entfallen,
ohne dass die Qualität leidet, sofern die Finanzierung gesichert ist. Ein vollständiger Verzicht auf Beiträge ist eine gute Möglichkeit zur Familienentlastung – deutlich wirkungsvoller als etwa Kindergeld. Allerdings hängt das stark von der finanziellen Lage des Kreises, der Kreisumlage und der Zusammensetzung des neuen Kreistags ab. Aktuell geht es primär darum, den Status quo zu halten; weitere Schritte sind nur möglich, wenn politische Mehrheiten und finanzielle Spielräume gegeben sind.
Frage 4:
Welche gezielten Maßnahmen gibt es, um Chancengleichheit zu gewährleisten – insbesondere für
Kinder aus Migrantenfamilien oder solche, die aus sozial schwachen Verhältnissen stammen? Wie
wird der Kreis den Sprachförderbedarf und den Bildungsrückstand ausgleichen?
Sabine Preiser-Marian:
Das Konzept des Kreisentwicklungsplans soll das berücksichtigen. Die Chancengleichheit &
Schulsozialarbeit soll weiter gestärkt werden.
Markus Ramers:
Sprache ist der Schlüssel zur Integration. Verantwortung darf nicht zwischen Institutionen hin- und hergeschoben werden. Aussagen wie „kein Deutsch, dann keine Schule“ sind problematisch. Sprachförderung muss in den Bildungseinrichtungen selbst stattfinden. Der Kreis setze hier auf Sprachförderkitas in Regionen mit hohem Migrationsanteil und unterstützt das „Kita-Rucksack“-Programm, das gezielt Kinder mit Migrationshintergrund und ihre Familien einbezieht. Auch Familienzentren können noch stärker als Anlaufstellen dienen. Ziel ist es, Familien, die ihre Kinder bisher nicht in die Kita bringen, durch Familienhilfe, Familienbüros oder Lotsen besser zu erreichen.
Ein weiteres Problem ist die reduzierte Schuleingangsuntersuchung aufgrund von Ressourcenmängeln
im Gesundheitsamt. Der gesetzliche Auftrag, alle Kinder zu untersuchen, kann aktuell nicht erfüllt
werden. Oft werden Untersuchungen nur dort durchgeführt, wo Kitas Bedarf melden, Kinderärzte
Auffälligkeiten feststellen oder Eltern selbst aktiv werden. Zwar betrifft das etwa 90 % der Kinder nicht,
dennoch ist die vollständige Untersuchung aller Kinder wichtig. Perspektivisch soll daher nicht nur auf
Ärztinnen, sondern verstärkt auch auf sozialmedizinische Assistentinnen gesetzt werden, um die
Aufgabe zuverlässig erfüllen zu können.
Frage 5:
Familien mit behinderten oder chronisch kranken Kindern stoßen oft auf hohe Hürden bei der Suche
nach geeigneten Betreuungsplätzen. Was tut der Kreis, um inklusive Angebote weiter auszubauen
und sicherzustellen, dass barrierefreie Bildung in allen Einrichtungen gewährleistet wird?
Sabine Preiser-Marian:
Das Thema ist sehr diffizil. Inklusion soll vorangetrieben werden, ist schwierig für Chancen-gleichheit.
Eine Folge ist eine hohe Belastung für Mitarbeiter, daher ist personelle Unter-stützung in Kitas und
Schulen erforderlich und muss bereitgestellt werden.
Markus Ramers:
Im Kreis gibt es bereits spezifische Angebote für Familien mit behinderten
Kindern. So wird ein Familientag für betroffene Familien organisiert. Zudem ist die Arbeit mit
Verfahrenslotsen etabliert, die Familien durch komplexe Prozesse begleiten und individuelle
Lösungen entwickeln. Gerade in 1:1-Fällen ist es wichtig, passgenaue Angebote für Kind und Familie
zu finden. Die Kooperation mit dem Familienbüro spielt dabei eine zentrale Rolle.
Frage 6:
Welche Aufgaben nehmen Sie sich in der kommenden Amtszeit zum Thema frühkindliche Bildung in
Einrichtungen vor?
Sabine Preiser-Marian:
Rahmenbedingungen mit den Ressourcen des Kreises schaffen (Jugend/Sozial), was im Austausch mit
den Kommunen erarbeitet werden soll. Frau Preiser-Marian sagt, sie ist gut vernetzt in Land & Bund und setzt sich für eine Änderung der erforderlichen Gesetze ein. Sie setzt sich auch Ziele die Situation zu verbessern, im Ansatz bei Mobilität und Wohnraum. Zudem muss das Ausbildungssystem stimmen
und die Infrastruktur muss dazu passen.
Markus Ramers:
Kindertagesbetreuung und Kindertagespflege sind entscheidend für gute Startchancen der Kinder und zur Unterstützung von Familien in einer herausfordernden Phase. Die Familienzentren möchte ich weiterentwickeln. Mit Blick auf den Rechtsanspruch auf OGS stelle sich die Frage, wie „dritte Orte“ als soziale Treffpunkte genutzt werden könnten, um den Sozialraum zu stärken.
Auch die Strukturen der Frühen Hilfen – etwa Babybesuche und der Austausch mit Ärzt*innen –
sollen wieder intensiver genutzt werden. Wichtig ist es zudem regelmäßig zu prüfen, welche Maßnahmen
tatsächlich wirksam sind und die Familien auch wirklich erreichen.
Ein weiteres zentrales Ziel bleibt die finanzielle Entlastung der Familien und eine Entbürokratisierung
im Beitragswesen. Außerdem muss klarer gesteuert werden, welche Aufgaben Jugendamt, Kreis
sowie Städte und Gemeinden jeweils übernehmen. Manche Angebote sind nicht unmittelbar in Zahlen messbar – gerade bei den Frühen Hilfen muss man auf qualitative Wirkung achten.
Wir bedanken uns bei beiden Kandidaten, für den offenen und sympathischen Austausch zum Thema Frühkindliche Bildung, Kita und Familie.